Touristen informieren
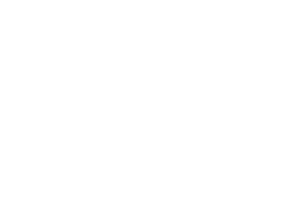
Stolpersteine
Die Stolpersteine sind ein Kunst- und Gedenkprojekt des deutschen Künstlers Gunter Demnig. Sie erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus, insbesondere an jüdische Mitbürger, politisch Verfolgte, Sinti und Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas sowie Zwangsarbeiter und andere NS-Opfer.
Was sind Stolpersteine?
- Stolpersteine sind kleine Messingtafeln, die in den Bürgersteig vor den ehemaligen Wohnhäusern der Opfer eingelassen werden.
- Jede Tafel trägt eine Inschrift mit dem Namen, dem Geburtsjahr und Informationen über das Schicksal der betreffenden Person, wie Deportation oder Ermordung.
- Das Motto des Projekts lautet: „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“
Wo gibt es Stolpersteine?
- Das Projekt begann 1992 in Deutschland und hat sich inzwischen auf viele europäische Länder ausgeweitet.
- Es liegen mittlerweile über 110.000 Steine in über 1860 Kommunen in 31 europäischen Ländern. Zusammengerechnet ist das Kunstdenkmal das größte Mahnmal der Welt.
Bedeutung der Stolpersteine
- Sie bringen das Gedenken an die Opfer des Holocausts in den Alltag der Menschen.
- Durch die Platzierung vor Wohnhäusern wird deutlich, dass die Verfolgten Nachbarn, Freunde oder Kollegen waren.
- Das Projekt lebt von Bürgerinitiativen, Schulen und Vereinen, die die Recherche und Finanzierung übernehmen.
Erinnern und Gedenken
Geschichte der Familie Friedland
Der aus Oldenburg stammende Kaufmann und Medizinal-Drogist Julius Friedland (geb. 29. Juli 1893) kam 1921 (über Köln) nach Hemer. In Köln-Kalk hatte er offensichtlich seiner Schwester Johanna Friedland in der Taunusstr. 47 beim Aufbau einer Kurzwarenhandlung geholfen, später dann in der Joh.Mayer-Str. 18 beim Einrichten einer Manufacturwarenhandlung. (lt. Kölner Adressbuch 1922).
Seit dem 28. März 1921 ist er offiziell in Hemer an der Märkischen Str. 110 gemeldet. Am 29. März 1921 heiratet er Elfriede Blumenthal (geb.15. Juli 1893), die Tochter von Baruch und Rebecka Blumenthal.
Trauzeugen bei der Heirat sind Elfriedes Bruder Max Blumenthal und ein Freund der Familie, Arthur Gottschalk. In der folgenden Zeit erlangt Julius offensichtlich bei den Hemeranern rasch gute Anerkennung und soziale Akzeptanz, so wird er bereits im Juli 1921 zum Schriftführer des neu gegründeten Schwimmvereins gewählt. (Märkischer Landbote 27. Juli 1921)
Als Kaufmann und Drogist übernimmt Julius das Ladenkokal von Elfriedes Schwager Salli Bartmann an der Märkischen Str. 110, weil Salli sein Lebensmittelgeschäft von dort zur Hauptstraße verlegt und eröffnet am 10. Sept 1921 in diesem Raum die Adler-Drogerie, die auch Lebensmittel führt. Ihr Geschäft wird gut von den Hemeranern angenommen. (S.176)1
Hinter dem Ladenraum befindet sich eine Wohnung mit 4 Zimmern, zu der wohl ein seitlicher Privateingang über mehrere Stufen und seitlicher Bepflanzung führte.
Julius ist als Geschäftsmann recht rührig und hat viele Ideen. Allerdings wird sein Gesuch, ihm den Kleinhandel mit Branntwein zu gestatten, von der Gemeindevertretung Hemers einstimmig abgelehnt, da „hierzu nicht das geringste Bedürfnis vorliege“ (ML 20. Juli 1924). Aber er entwirft er z.B. folgende Zeitungsanzeige, die am 27. Sept.1924 im Märkischen Landboten erscheint:
I.R. seines sozialen Engagements initiiert Julius z.B. als Sanitäter des Roten Kreuzes einen kostenlosen Krankentransport.
Die Tochter Ruth wächst als Kind bei den Eltern in der Märkischen Str. 110 recht behütet auf. Sie besucht die nahgelegene Evangelische Ostschule, heutige Woesteschule, und wird von ihren Mitschülern als „nettes Mädchen“ wahrgenommen (lt. Zeitzeuge Erich Grete)63. Allerdings sei sie dann irgendwann plötzlich nicht mehr dabei gewesen,- man hörte nur, sie gehe jetzt nach Menden zur Schule. Seitdem habe er sie nie mehr gesehen. (Eine drastische Folge der offiziellen Maßnahmen zur Rassentrennung schon bei Kindern.)
Dem Vorbild des Vaters folgend ist Ruth offensichtlich sehr hilfsbereit und insbesondere jüngeren Kindern sehr zugetan, so fährt sie z.B. mit der 7 Jahre jüngeren Eleonore Gottschalk per Straßenbahn nach Iserlohn ins Schwimmbad, um der Kleineren dort das Schwimmen beizubringen.
Die familiären Idylle der Familie Friedland wird durch zunehmende antisemitische Tendenzen im Umfeld bedroht: immer wieder kommt es zu provokativen Konfrontationen, so wird im Märkischen Landboten (ML) (gewiss nicht korrekt objektiv) bereits 1924 eine Situation beschrieben, in der Friedland emotional stark reagiert und die Beherrschung verloren haben soll, getriggert durch das Hakenkreuz als Symbol der Nationalsozialisten. Dabei habe er einen die Hakenkreuz-Fahne tragenden jungen Mann heftig attackiert und beleidigt, - was in der Zeitung ausdrücklich gerügt und verurteilt wird. (ML 2. Okt. 1924)3
Die Anmerkungen des Buches „Juden in Hemer“ zur Berichterstattung der Presse in der damaligen Zeit weisen darauf hin, dass damals sehr einseitig zu Lasten der jüdischen Bevölkerung geschrieben wurde. Insofern müssen solche Presseartikel unbedingt relativiert werden. (S. 90) 1. So kann man sich kaum vorstellen, dass Julius Friedland einen Menschen angreift, nur weil der eine Hakenkreuz-Fahne trägt. Julius fühlt sich wie viele damalige Juden in Deutschland als ehemaliger Frontsoldat aus Überzeugung deutschnational. Zugleich spürt er schon sehr früh, nämlich bereits unmittelbar nach der Machtergreifung, die zunehmenden antisemitischen Verhaltensweisen seiner Mitmenschen. Aber er nimmt diese nicht einfach hin, sondern argumentiert sachlich und beharrlich dagegen:
Ein Brief an seine Reservistenkameraden dokumentiert 1933 Julius´ Skepsis den neuen Strömungen gegenüber. Darin erklärt er deutlich, dass er keinesfalls „nur geduldet“ sein will, sondern dass er sich seinerseits als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft fühlt.
Im November 1933 kommt es zu einer erneuten noch deutlich drastischeren Konfrontation:
Julius (weil Jude) wird mittels polizeilicher Anordnung unter Androhung von Zwangsgeld aufgefordert, die Deutschlandfahnen aus seinem Schaufenster zu entfernen, „da die Aushängung dieser Fahnen in seinem Schaufenster geeignet sei, das Empfinden von der Würde dieser Fahnen zu verletzen“. Weil er dieser Aufforderung zwar nachkommt, dabei zunächst einzelne Exemplare übersieht, erfolgt eine erneute „Androhung einer Geldstrafe von 50 RM, falls er die Aufforderung binnen 10 Minuten nicht erfülle“. Er reagiert freiwillig gehorsam,- schreibt aber zu seiner Verteidigung in einem Brief an den Bürgermeister, dass er dies Vorgehen der Behörde als völlig ungerechtfertigt ansieht und argumentiert sehr klar seinen Standpunkt. (S. 92-94)1 (S.256-257)2
(Originaldokumente im Stadtarchiv)4
Übrigens ist Julius Friedland nicht der einzige mit solchem „Fahnenärger“: im Stadtarchiv findet sich auch das Original einer polizeilichen Anordnung gegen seinen Schwager Salli Bartmann. (In derselben Akte des Stadtarchiv Hemer 246/8)4: Am 10.11.33 wird Salli vorgeworfen, er habe die Würde der Fahne, die an seinem Geschäftshaus hing und als nationales Symbol betrachtet wurde, verletzt. Er gibt wohl letztendlich nach, bevor dann die Polizei die Fahne entfernt und ihn dafür belangt hätte.
Am 28./29.9.1935 wird Julius Friedland wie Siegmund Bartmann Opfer von vermutlich organisiertem Vandalismus gegen sein Geschäft. Es wird berichtet, dass die Fenster der Drogerie eingeschlagen wurden. (S.122-125)1
Boykott und Arisierungsdruck zermürbt und bewirkt erhebliche Umsatzrückgänge, sodass Julius und Elfriede schließlich die Drogerie verkaufen müssen.
Der Neffe Karl Becker formuliert 1956 in einem Brief an die Wiedergutmachungsbehörde zusammenfassend Folgendes:
Der Kaufvertrag (der im Hemeraner Stadtarchiv aufbewahrt wird)4 dokumentiert, dass die Drogerie offiziell der Ehefrau des Julius Friedland gehörte und am 7.2.36 per Vertragsunterzeichnung an den Drogisten Friedrich Spielfeld verkauft wurde, wobei Salli Bartmann, Elfriedes Schwager, der zugleich sachverständiger Kaufmann war, als Bevollmächtigter fungierte.
Es werde im Einzelnen sämtliche Bestandteile der Ladeneinrichtung und der Kaufpreis benannt, sodass man eine konkrete Vorstellung von der Inneneinrichtung bekommt und zugleich die fragwürdige Werteinschätzung erahnen kann:
Nach dem Verkauf der Drogerie erfolgt die „Abmeldung zum 14.3. mit Wirkung vom 13.3.36“, sodass Herr Spielfeld den Erwerb zum 13.3. verkünden kann.
Bereits am 4.3.1936 zieht Familie Friedland aus der hinter dem Laden gelegenen 4 Zimmerwohnung von der Märkischen Straße zur Bahnhofstr. 11 in das von Schlieper bereits 1902 erbaute Haus, - in eine Wohnung im Erdgeschoss. Diese sog. „Schliepersche Villa“ stand also rechts der Einmündung des heutigen Spiethländerweges, also neben dem jetzigen „alten Hallenbad“.
Im Stadtarchiv kann die „Abbruchsakte“ eingesehen werden, die auch recht detaillierte Baupläne enthält:
Dort eröffnen sie am 2. Mai 1936 eine Verkaufsstelle von Drogerieartikeln, Gewürzen und Tee und seit dem 30. März 1937 auch von pharmazeutischen und kosmetischen Artikeln.
In der Progromnacht im November 1938 werden aber auch bei ihnen die Scheiben eingeworfen, so hat es Erich Grete damals beobachtet63. Zunehmender Boykott führt erneut zu Umsatzeinbußen und schließlich müssen sie am 6. Februar 1939 das Gewerbe komplett abmelden. (dokumentiert in der Gewerbekartei des Stadtarchivs)4
Bereits am 3. Dezember 1938 hatte Julius einen Antrag an die Devisenstelle des Oberfinanz-präsidenten in Münster gestellt, ob er bei einer geplanten Auswanderung in die USA 150 kg eines Präparates (Salicylsäure in Pulverform) mit einem Wert von unter 1.000 M ausführen zu dürfe. Ihm sei bekannt, dass Personen, die sonst keine Vermögenswerte besitzen, Waren in die neue Heimat mitnehmen dürften. Er wolle das Pulver mitnehmen, um seine Familie durch dessen Verkauf unmittelbar nach der Einwanderung in die USA unterhalten zu können, da er sonstige Vermögenswerte nicht besitze.
Am 6. Dezember 1938 erfolgt eine knappe den Antrag ablehnende Antwort des Oberfinanz-präsidenten in Münster, - ohne Begründung.
Lt. Angaben auf ihrer eigenen Meldekarte4 hält sich die damals 14Jährige Ruth in der Bahnhofsstr.11 nur kurz auf, sie wechselt bereits am 5.6.1936 nach Iserlohn, wo sie ab 15.6.1936 als Hausangestellte unter der Adresse Wasserstraße 2 gemeldet ist. (Stadtarchiv Iserlohn)5
Vermutlich ist sie dort bei der jüdischen Familie Walter Ehrlich beschäftigt, den Besitzern des Kaufhauses Ehrlich, die zwei Söhne haben: den 10jährigen Heinz Richard und den 6jährigen Kurt Günter.
Nach 1,5 Jahren also Anfang Januar 1938 zieht Ruth weiter nach Hagen, Litzmannstraße 18, später Heidestraße. Darüber lassen sich im Hagener Stadtarchiv aufgrund Kriegszerstörungen keine konkreten Nachweise mehr finden.
Am 4. Feb. 1939 erfolgt ein erneuter Umzug, diesmal nach Köln an die Hohe Pforte 16. (Stadtarchiv Köln)5,8 In diesem Haus in Köln wohnt ihre Tante Irma Koll, eine jüngere Schwester von Julius, mit ihrer Familie, nämlich dem nicht jüdische Ehemann Wilhelm Koll und den Söhnen Dagobert, geb. 9.03.1921 und Bernd, geb. 29. Nov. 1932. 7
Auch Ruths verwitwete Großmutter Dora Friedland und Julius ebenfalls bereits verwitwete Schwester Rosalie Ascher, geb. Friedland, leben in Köln, nämlich in der Feldbergstr. 5a, wo die Großmutter Dora ein Kurz- und Weißwarengeschäft hat. Desweiteren befinden sich dort in der Stadt Julius Schwestern Henriette Wolf, geb. Friedland, Johanna (Hanni) Gabske, geb. Friedland, genauso wie der Bruder Max (gelernter Mechaniker), die Schwester Helga und der jüngste Bruder Jacob. Also eine recht große Familie mit vielen Mitgliedern, deren individuelle Schicksale allerdings sehr unterschiedlich aber allesamt belastet vom zunehmenden Antisemitismus verlaufen.7 So lebt die Großmutter nach erzwungener Aufgabe ihrer Geschäftstätigkeit (Korsett- und Kurzwarenhandlung, Schuhverkauf) bereits seit 1938 im sog. Judenhaus an der Kurfürstenstr. 18.
Nach einem Monat bei der Familie in Köln kehrt Ruth am 12. März 1939 zurück nach Hemer und ist für 3 Monate bei ihrem Onkel Max Blumenthal, dem Bruder ihrer Mutter, in der Ohlstraße 74 gemeldet.4
Von dort geht Ruth am 7. Okt.1939 als inzwischen 17-Jährige für 1 Jahr nach Berlin-Grunewald in die Wangenheim Str. 36,4 offensichtlich um im „Jüdischen Seminar für Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen“ die einjährige Ausbildung zur Kinderpflegerin zu machen, die eine international anerkannte Qualifizierung vermittelt.10
Und höchstwahrscheinlich gilt für Ruth dasselbe wie für Esther Cohn, 12 sie begann im Oktober 1939 einen Kursus zur Einführung in die Kinderpflege und -erziehung im „Jüdischen Seminar für Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen“ in der Wangenheimstraße 36 im Grunewald. Neben der seit 1934 bestehenden Ausbildung zur Kindergärtnerin wurden hier seit 1938 in halb- und einjährigen Kursen Mädchen und Frauen für die Arbeit in einem Haushalt mit Kindern ausgebildet.
Nach Abschluss dieser Ausbildung kommt sie im Okt. 1940 aus Berlin zurück und verlässt 2 Monate später Hemer erneut4, um in Kassel in der Große Rosenstr.22 im dortigen Jüdische Gemeindehaus ca. ein Jahr als Kinderpflegerin/ Erzieherin zu arbeiten (vom 2.12.1940 bis zum 17.11.41).
So ist es im Kasseler Stadtarchiv einerseits13, aber auch in einer polizeilichem Meldeliste im Arolsen Archiv dokumentiert.15
Angesichts der Tatsache, dass 2 Jahre zuvor (also im Jahr 1938) die jüdische Gemeinde in Kassel deutschlandweit erstes Ziel der Nazi Progrome gewesen ist14, also eine Art Vorreiterrolle bei der Eskalation der antisemitischen Maßnahmen hatte, sicher eine mutige Entscheidung!
Bilder aus den Kasseler Archiven14 illustrieren die Progrom-Folgen am Morgen des 8. November 1938, also einen Tag vor den deutschlandweiten Zerstörungen, waren recht drastisch:
Lt. Eleonore/Shoshana Avimeir-Gottschalk hatte Ruth aber ihren Mut von ihrem Vater geerbt! Insofern passen solche erstaunlichen Wege zu ihrem Naturell. Aus den Beschreibungen von Shoshana Avimeir-Gottschalk wissen wir, dass Julius Friedland von den anderen Juden damals sehr verehrt wurde, weil er die Schikanen der Nazis nie als Schicksalsschläge sah, sondern immer versuchte, etwas dagegen zu tun: Als z.B. im Sept. 1941 die Verordnung erlassen wurde, dass man den Judenstern tragen musste, hängte Julius Friedland alle seine Orden und Auszeichnungen vom 1. WK neben den Judenstern. Das wurde natürlich sofort verboten,- und er musste dem Folge leisten. Aber es zeigt sein mutiges Oponieren. Im Gegensatz zu Julius war Elfriede Friedland oft sehr deprimiert und sprach von ihren Tränensäcken. (schildert Shoshana Avimeir-Gottschalk).
Nach ihrer Rückkehr im November 1941 ist Ruth dann aber wieder bei den Eltern in der Bahnhofstr. 11 angemeldet. Am 9.12.1941 ziehen die drei (weil sie nahezu mittellos sind) in eine Baracke an der Naumberg-Str.2, dem Alten Amtshaus gegenüber (heute Auf dem Hammer). Dort war also der letzte offizielle, aber unfreiwillige Wohnort der Familie.4
In der Wiedergutmachungsakte für die Erben von Elfriede Friedland im Archiv des Märkischen Kreises (Sign.: Is 500-515) findet sich ein Schreiben vom Neffen Karl Becker aus Neheim-Hüsten, der für die Blumenthals später die Behördenangelegenheiten regelte, adressiert an den Kreisdirektor des Kreises Iserlohn vom 25.1. 1961 (Betreff: Entschädigungsantrag nach Frau Elfriede Friedland, geb. Blumenthal) mit folgendem Wortlaut:
„Wie aus den Akten ersichtlich ist, mußte Frau Friedland mit Ihrer Familie in eine B a r a c k e, von hier wurden sie dann zwangsverschleppt." 4
Bei den Hemeraner Anwohnern hießen die vorderen beiden Gebäude an der damaligen Naumberg-Str. 2 "Große und kleine Hallen". Sie waren zunächst für die Arbeiter der Firma Paschedag, später Grohe, gebaut. In und nach den Kriegsjahren wurden sie von der Stadt als Notunterkünfte für ausgebombte Familien aus dem Ruhrgebiet genutzt.
Wie die Zeitzeugin Shoshana Avimeir-Gottschalk bestätigt, war dies erzwungenermaßen dann der letzte Wohnort der Familie Friedland. Sie berichtet sehr konkret, dass die Lebensbedingungen dort besonders im Winter 1941/42 schwer waren. Das Gelände war nämlich überschwemmt, man musste auf Planken gehen, um zu ihnen zu kommen und die Feuchtigkeit drang auch in ihre Wohnung ein. Telefon gab es dort nicht,- stattdessen wurde Julius Friedland öfter von Eleonore Gottschalk, (der heutigen Shoshana Avimeir-Gottschalk), ans Telefon bei den Gottschalks gerufen, da diese nicht weit weg in der Hauptstraße 119 wohnten.
Zeugenaussagen aus den Wiedergutmachungsakten bestätigen, dass die Friedlands in dieser Baracke gegenüber dem Amtshaus Hemer gewohnt haben,- denn in Akte K104 Nr. 460690 findet sich eine Statement des Amtsoberinspektor Rudolf Hinkel, wohnhaft Breddestr. 16, das besagt, dass Frau Friedland , geb. Blumenthal in dieser Baracke wohnte, und dass er an der Wohnungstüre den Judenstern ( damals als obligate Kennzeichnung einer Wohnung für Juden verpflichtend) dort gesehen habe:
Aus der Wiedergutmachungsakte K104 Nr. 460701 kann man entnehmen, dass Elfriede bereits am 27.3.1942 auf Anordnung der Gestapo festgenommen und ins Polizeigefängnis nach Dortmund abgeführt und in Schutzhaft genommen wird, wobei über Begründung oder Dauer dieser Maßnahme ist nichts genannt wird.
Nur das Faktum als solches wir durch den Auszug aus dem Festnahmebuch Lfd. Nr 9 von 1942 bestätigt und auch in späteren Dokumenten so wiederholt:
Am 27. Juli 1942 wird das Ehepaar Friedland und Tochter Ruth dann von der Gestapo aus der Naumbergstr. 2 abgeholt und über Dortmund am 29. Juli mit dem 2. großen Transport nach Theresienstadt deportiert.4,17,18 (S.144)1 (S.248)2
Nach den Eintragungen beim Einwohnermeldeamt wurden sie am 27.07.1927 mit unbekanntem Verbleib abgemeldet.
Am 30. Juli soll Ruth noch christlich getauft worden sein,- konkrete schriftliche Belege dafür lassen sich bislang aber nicht auffinden. Nachvollziehbar wäre es aber sicherlich als “letzter Versuch“ dem furchtbaren Schicksal zu entgehen. 16
Der Transport nach Theresienstadt X/1 30.7.1942 ist durch die Theresienstadt-Kartei dokumentiert.
Die Belege werden im Arolsen Archiv aufbewahrt17,18:
Die 3 Original-Karteikarten bestätigen sowohl den Transport nach Theresienstadt als auch den jeweilig individuellen Weitertransport nach Auschwitz17:
Julius am 28.09.1944 Ek Nr. 1274
Ruth am 1.10.1944 Em Nr. 1211
Elfriede am 6.10.1944 Eo Nr. 352
Erstaunlicherweise heiratet Ruth in Theresienstadt einen Herrn Sausmikat, so wird es im Buch „Juden in Hemer“ erwähnt und von anderen Quellen dann aufgegriffen, allerdings lassen sich hierzu bislang keine offiziellen Belege finden. (S.142)1 (S.248)2
Ganz offensichtlich zeigt es den Lebenswillen, den die Menschen sich selbst unter diesen schwierigsten Bedingungen erhalten wollten und ist ein Beispiel für den unglaublichen Mut, auch im Ghetto Beziehungen einzugehen und gemeinsam Hoffnung zu haben.
Ruth ist am 1.Oktober 1944 ihrem Mann Sausmikat nach Auschwitz gefolgt, aber nur er überlebt.21,22,23,24,25,26
Zeitzeugen berichten, er habe nach dem Krieg bei den überlebenden Verwandten der Friedlands in Hemer erfolglos nach Ruth gesucht. (S. 248)2, 18,19
Auch die Eltern Julius und Elfriede werden von Theresienstadt nach Auschwitz weiterdeportiert (am 28. Sept 1944 und am 6. Okt. 1944). Beide werden dort ermordet. 21,22,23,24,25,26
(142)1 (S.248)2
Julius Mutter, Dora Friedland, geb. van der Rhoer, Jg 1866, wurde 1941 zusammen mit ihrer jüngeren Tochter Henriette aus Köln ins Ghetto nach Riga deportiert.31 Die Tochter Rosa wurde von Köln nach Litzmannstadt und weiter nach Kulmhof gebracht und dort ermordet. 29,31
Ihre 3 Stolpersteine finden sich in Köln in der Kurfürstenstraße 18, wo damals ein Judenhaus war, in das man sie als letzte Kölner Wohnstätte verbracht hatte.27,28,30,33
Julius Schwester Johanna, genannt Hanni, verheiratete Gabske, überlebte auf unbekannte Weise den Holocaust. Sie blieb in Köln, starb am 22.12.1970 und ist auf dem jüdischen Friedhof in Köln Bocklemünd bestattet.7,32
Der jüngere Bruder Max Friedland war bereits im Juli 1914 als 17jähriger junger Mann als „Sailor“ nach New York gefahren, wie man einem Dokument über die Schiffspassage entnehmen kann.33
Er kehrte er aber zurück und heiratete später in Köln die Protestantin Frieda Diehl7. Sie hatten eine Tochter namens Ellen.7 Als Familie konnten die drei nach dem Krieg emigrieren7: 1951 ist ihre Ausreise mit dem Schiff General Muir von Bremerhaven nach New York dokumentiert (Ziel Cleveland, Ohio).35
Helga Friedland war mit Wilhelm Olbertz, einem Nichtjuden, verheiratet. Gemeinsam mit ihrer Tochter Käthe Dora konnte sie sich in der NS-Zeit verstecken und überleben.7,34
Die helfenden Familien wurden als „Gerechte unter den Völkern“ von Yad Vashem geehrt (wie aus der Dokumentation der Museen Köln ersichtlich ist).7,34
Irma Friedland, verheiratet mit Wilhelm Koll, bei der Ruth im Februar 1938 zu Besuch war, hat mit ihren beiden jüngeren Söhnen überlebt, während der Älteste, Ruths Cousin Dagobert (1921 geboren) leider deportiert und ermordet wurde.7
Beeindruckende Statements von Irma und Ruths Cousin Bernd über die furchtbaren Erlebnisse als diskriminierte Juden im Krieg sind bei den Kölner Dokumenten abrufbar. 7,36
Shoshana Avimeir-Gottschalk berichtet, dass sie nach dem Krieg zusammen mit Bernd ( den sie Benny nennt) in einem Kinderheim in Blankenese bei Hamburg für Kinder und Jugendliche Holocaust-Überlebende war und dann mit einer Gruppe von dort im Mai 1947 nach Israel eingewandert ist.
Sie sei bis zu seinem Tod vor ein paar Jahren mit ihm befreundet gewesen. So weiß sie, dass er mit über 80 Jahren nochmal geheiratet hat.
Julius jüngster Bruder Jakob/James Friedland konnte 1933 mit seiner Frau Ilse, geb. Rosenberg nach Palästina emigrieren. 37,38 Am 29.12. 1936 wurde ihr Sohn Uriel David geboren.7,37
Die Verwandtschaft auf Elfriedes Seite, die große Familie Blumenthal wird parallel aufgearbeitet.
Aus einer Übersicht (Tabelle Blumenthal) ergibt sich, dass es von den insgesamt 11 Geschwistern nur 4 den Holocaust überlebten, wobei Paul Blumenthal bereits als Kleinkind im Jahre 1897 10 Tage nach seiner Geburt verstarb. Somit sind 6 der 11 Geschwister den Nazis zum Opfer gefallen.
Für Elfriedes ältere Brüder, die aus Hemer wegzogen, gibt es bereits Stolpersteine an ihren jeweiligen letzten Wohnorten:
Siegmund Blumenthal (geb. 29 Sept. 1875) verstarb im Ghetto Theresienstadt.21,40,41,42 Er wird wie auch seine Ehefrau Mathilde Blumenthal (geb. 7.9.1874) mit einem Stolperstein Oberhausen an der Buschhausenerstr. 58 geehrt.39,43
Sally Blumenthal (geb. 27. Jan. 1878) versuchte, noch über Holland nach Belgien zu fliehen, wurde dann aber ab Mechelen (Malines) am 15. Sept. 1942 deportiert und am 13.01. 1942 in Auschwitz ermordet.21,46 Sein Stolperstein befindet sich in Mönchengladbach an der Marienkirchstr. 49, zusammen mit den Steinen für seine Ehefrau Mathilde (geb.7.9.1874)47 und seine Söhne Erich und Walter.44,45,46
Elfriedes Bruder Max (geb. 12. Feb. 1880) wurde am 28. April1942 von der GESTAPO aus der Ohlstr.74 abgeholt4 und am 30. April wie ihre Schwester Mathilde (geb. 10.Feb. 1884) und deren Mann Sally Bartmann von der Hindenburgstr. 139 - von der Gestapo verhaftet, nach Dortmund zur Sammelstelle gebracht und zusammen mit vielen anderen in das Ghetto Zamosc deportiert4. Wie oder wo genau sie zu Tode kamen, ist nicht bekannt.21
Elfriedes Bruder Josef konnte mit seiner Ehefrau Rosa (wie seine beiden Söhne Kurt52 und Berthold schon zuvor) 1939 über Luxemburg in die USA emigrieren.4,50
Er starb am 2.3.1958 mit 75 Jahren in New York.48,49
Beide Söhne änderten nach der Emigration ihren Namen in Vallée,- Bert Vallée, der seinen Weg über das Medizinstudium in der Schweiz gemacht hatte, wurde ein sehr erfolgreicher Wissenschaftler.51
Er starb kinderlos am 7. Mai 2010 in den USA.
Johanna Blumenthal (geb. 10. Jan 1886) wurde noch im Januar 1945 abgeholt und bis Berlin gebracht, konnte aber bei Kriegsende von dort lebend zurückkehren. Sie war verheiratet mit Carl Becker und lebte mit ihm in Neheim-Hüsten. Ihre beiden Söhne hießen Carl Baruch und Werner. Johanna verstarb am 10. Jan. 1953 mit 67 Jahren in Neheim-Hüsten.53,54,55
Isidor Blumenthal (geb. 12. Nov. 1887) wird in einer ausführlichen Biografie separat gewürdigt, denn er hatte ein besonders schweres Schicksal und überlebte das KZ Auschwitz, musste aber danach noch Zwangsarbeit in Russland leisten und kam schließlich sehr krank nach Hemer zurück. Er verstarb 1955 und wurde als letzter Jude auf dem Friedhof am Perick beigesetzt.4
Die 3 Jahre jüngere Schwester Lina (geb.25. Okt. 1890) heiratete 1914 Heinrich Bartmann. Ihre Tochter Betty wurde am 17. März 1915 geboren. Die Ehe wurde geschieden und am 6.7.24 heiratete Lina dann Herrn Gass. Sie wurde nach Zamosc deportiert und am 28. Feb. 1944 im KZ Ravensbrück ermordet.4,56,57,58
Der kleine Bruder Paul Blumenthal (geb. 22. Mai1897) verstarb bereits mit 10 Tagen.4
Der Jüngste der Familie, Oskar Blumenthal (geb. im Juli1899) konnte über Schweden fliehen und dann in die USA emigrieren.4 Er lebte dort in Indiana mit seiner Frau Toni und verstarb im August 1975 .59,60,61
Quellen:
H.-H. Stopsack (Hrsg), W. Gröne, H.-H. Stopsack, P. Klagges, E. Thomas
Juden in Hemer, Spuren ihres Lebens, Menden und Hemer 1998
Seite 92-94, 112, 142, 176, Tabelle am Buchende
Sirringhaus, Friedrich
Alt-Hemer
Bilddokumente über die Wandlung einer Stadt, Hemer 2. Auflage 1987, S. 246-257
Paul Kramme, Aus der Heimat für die Heimat
Märkischer Landbote/ Hemersche Zeitung
Juli 1918-Juni 1934
Stadtarchiv Hemer
Stadtarchiv Iserlohn
Stadtarchiv Köln
NS-Dokumentationszentrum Köln
https://altes-koeln.de/images/1/11/Hohe_Pforte_16.jpg
Arbeitskreis „Schulen“ des BVH ,Lt. R.Gräve, Hemeraner Schulgeschichte(n), 2007, S.25
https://www.stolpersteine-berlin.de/de/niebuhrstr/72/ernestine-ester-cohn
Stadtarchiv Kassel
https://kassel.deutsch-israelische-gesellschaft.de/gedenkort-gr-rosenstr-22/
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/70442391
https://www.myheritage.de/profile-1269890722-1500040/ruth-hemer-t-a-sausmikat-friedland#
https://collections.arolsen-archives.org/de
https://collections.yadvashem.org/de/deportations/5092410
Zeitzeugenbericht: Erinnerungsprotokoll von Pastor Wilhem Gröne mit Hannelore Diekow, geb. Blumenthal und ihrer Nichte Petra Schumacher, geb. Blumenthal vom 18.5.1924
Zeitzeugenbericht: Erinnerungsprotokoll von Gisela Knauel mit Hannelore Diekow, geb. Blumenthal, am 25.06.2024
Bundesarchiv Gedenkbuch: https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch
Yad Vashem Sammlung: https://collections.yadvashem.org/de/names/4744216
Jüdische Holocaust-Gedenkstätten und jüdische Einwohner Deutschlands 1939-1945: https://www.myheritage.de/research/collection-10789/judische-holocaust-gedenkstatten-und-judische-einwohner-deutschlands-1939-1945?itemId=119197-&action=showRecord&recordTitle=Elfriede+Friedland+%28geb.+Blumenthal%2
Jüdische Opfer der Nationalsozialistischen Verfolgung 1933-1945: https://www.myheritage.de/research/collection-10921/deutschland-judische-opfer-der-nationalsozialistischen-verfolgung-1933-1945?itemId=123114&action=showRecord&recordTitle=Ruth+Friedland
Deportationslisten Westfalen Dortmund nach Theresienstadt: https://www.statistik-des-holocaust.de/list_ger_wfn_420729.html
Holocaust Opferdatenbank: https://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer/11249-julius-friedland/
https://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer/11246-elfriede-friedland/
https://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer/11250-ruth-friedland/
https://museenkoeln.de/NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM/default.aspx?sfrom=1214&s=2460&id=3425&buchstabe=F
https://museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum/
https://museenkoeln.de/NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM/default.aspx?sfrom=1214&s=2460&id=246&buchstabe=F
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1572101
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de834323
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1008085
https://www.museenkoeln.de/downloads/nsd/EL-DE-Info-11-08.pdf
NS-Dokumentationszentrum Köln Signatur N 3025
https://stolpersteine.wdr.de/web/de/stolperstein/5569
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/5022070
https://www.nrz.de/staedte/oberhausen/article999572/ein-dutzend-schicksale.html
https://www.moenchengladbach.de/de/stolpersteine ausführliche Biografie verlinked
https://stolpersteine.wdr.de/web/de/stolperstein/9403
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/5278133
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/5022029
https://www.myheritage.de/person-1500051_307455971_307455971/josef-hemer-u-blumenthal
https://www.geni.com/people/Josef-Blumenthal/6000000107539397134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8707161/
https://www.myheritage.de/profile-1269890722-1500003/kurt-blumenthal#
https://www.geni.com/people/Johanna-Becker/6000000107538127107
https://www.geni.com/people/Lina-Gass/6000000107541293990
https://www.geni.com/people/Oskar-Blumenthal/6000000107540874018
Kölner Adressbuch 1922-1942
Zeitzeugen Bericht Erich Grete (9.08. und 20.11.2024)
Geschichte der Familie Samuel Salli Bartmann
Die Familie Bartmann, namentlich Samuel Salli Bartmann, Mathilde Bartmann und ihre Söhne Siegmund und Erich Hans Bartmann, erlebte in den Jahren vor und während des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts unvorstellbares Leid.
Samuel Salli Bartmann, ein erfolgreicher Kaufmann aus Hemer, begann bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit seinem eigenen Geschäft. Durch seine wirtschaftliche Tätigkeit genoss er hohes Ansehen, sowohl bei jüdischen als auch nicht-jüdischen Kreisen. Doch nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten erlebte er zunehmend Diskriminierung und Verfolgung. 1935 wurde er bei einem von der NSDAP organisierten Übergriff in Hemer verhaftet und 1939 gezwungen, unter dem Druck der "Judenvermögensabgabe" sein Haus zu verkaufen. Im Jahr 1942 wurde er ins Ghetto Zamocz deportiert und verschwand später im Konzentrationslager Belzec, wo er ermordet wurde.
Mathilde Bartmann, geb. Blumenthal, erlebte ähnliche Gräueltaten. Sie wurde 1942 verhaftet und kurz darauf im April 1942 mit ihrem Mann deportiert. Auch sie wurde in das Ghetto Zamocz deportiert und verschwand auch 1942 im Konzentrationslager Belzec, wo sie ermordet wurde.
Siegmund Bartmann, der älteste Sohn, floh nach dem Reichspogrom im Jahr 1938 in die USA. In der Folge wurde er 1941 zum Soldaten der US-Armee eingezogen und verbrachte Zeit in Persien (dem heutigen Iran), wo er als Kranführer für Schiffsentladungen arbeitete. Nach dem Krieg war er als Kaufmann in den USA tätig und heiratete 1946 Luise Finkeldey. Auch seine Söhne Harold und Randall Bartman wurde in den USA geboren.
Erich Hans Bartmann, der jüngere Sohn, durchlebte einen ähnlichen Schicksalsweg. 1938 wurde er während der Reichspogromnacht verhaftet und ins Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert. Nach seiner Freilassung im Jahr 1939 zahlte er die Auswanderungsabgabe und emigrierte nach England. Später wanderte er nach Chicago aus, wo er nach dem Krieg wieder als Bankkaufmann arbeitete. Er heiratete Frieda, und ihr Sohn Howard wurde 1951 geboren.
Zusammenfassung:
Die Familie Bartmann erlebte die grausamen Auswirkungen der NS-Verfolgung, die sowohl ihre Existenz zerstörte als auch zu einer umfassenden Entwurzelung führte. Der Verlust von Familienmitgliedern durch Mord und Deportation sowie die Zerstörung ihrer wirtschaftlichen Basis hinterließen tiefe Narben. Die Überlebenden, wie Siegmund und Erich Hans Bartmann, mussten nicht nur mit den persönlichen Verlusten und dem Trauma leben, sondern auch mit der anhaltenden Diskrepanz zwischen der neuen Heimat und der Erinnerung an das verlorene Leben in Deutschland.
Recherche und Text:
Antonia Friedrich und Eduard Schenk,
auf der Basis des Buches „Juden in Hemer – Spuren ihres Lebens“ (Ausgabe 1998)
Fotos: aus dem vorgenanntem Buch und Privat
Stolpersteine
als Erinnerung an die jüdische Familie
Samuel Salli Bartmann,
letzter Wohnort in Hemer,
Hindenburgstraße 131, (heute Hauptstraße 265)
HIER WOHNTE
SALLI BARTMANN
JG. 1882
DEPORTIERT 1942
GHETTO ZAMOCZ
BELZEC
ERMORDET
HIER WOHNTE
MATHILDE BARTMANN
GEB. BLUMENTHAL
JG. 1884
DEPORTIERT 1942
CHETTO ZAMOCZ
BELZEC
ERMORDET
HIER WOHNTE
SIEGMUND
BARTMANN
JG. 1903
Flucht 1938
USA
HIER WOHNTE
ERICH HANS
BARTMANN
JG. 1906
Flucht 1939 ENGLAND
USA
Die Geschwister Reinsberg
Ida Gottschalk, Hemer, Hauptstraße 119
Ida Gottschalk wurde am 20. Dezember 1887 in Hemer als eines von neun Kindern des Pferdehändlers Bernhard Gottschalk geboren. Nach der Schule arbeitete sie in der Manufakturwarenhandlung „Geschwister Gott-schalk“ die sie später übernahm. Der frühe Krebstod ihrer älteren Schwester brachte ihr die Verantwortung für deren Töchter Liese und Lotte. Wie damals oft üblich, sollte sie auch den Witwer ihrer Schwester heiraten, doch dieser fiel 1916 in Galizien. So zog sie die Zwillinge allein groß.
Die drohende Gefahr erkannte sie früh und floh bereits 1933 mit den beiden sowie deren Bruder Erich nach Amsterdam. Doch die Flucht bewahrte sie nicht vor dem Grauen. Sie musste mit ansehen, wie zuerst Erich und dann Liese deportiert wurden, bevor auch sie selbst am 23. Januar 1943 von Westerbork nach Auschwitz verschleppt und dort am 26. Januar 1943 ermordet wurde.
Erich Reinsberg, Hemer Hauptstr. 119
Erich Reinsberg wurde am 11. Januar 1909 in Hemer geboren. Nach dem frühen Tod der Eltern wurden er und seine Schwestern zu Vollwaisen. Während die Zwillinge bei Ida aufwuchsen, kam er in die Obhut einer anderen Tante. Nach der Realschule wurde er Kaufmann und arbeitete unter anderem in Berlin. Diese Erfahrung half ihm und seinen Schwestern nach der Flucht nach Amsterdam bei der Gründung des Konfektionsgeschäfts „Gezusters Reinsberg“.
Dort verliebte er sich auch in die junge Irma Jeanette, die er am 9. Januar 1936 heiratete. Doch das Glück währte nur kurz. Erich wurde Opfer einer Vergeltungsmaßnahme der deutschen Sicherheitspolizei. Er gehörte zu den ersten 389 jungen jüdischen Männern, die im Februar 1941 aus den Niederlanden in das KZ Buchenwald deportiert wurden. Im Mai wurde die Gruppe in das KZ Mauthausen verlegt, wo die Häftlinge durch schwerste Zwangsarbeit systematisch zu Tode geschunden wurden. Schon Anfang Oktober 1941 lebten nur noch 64. Erich Reinsberg starb am 10. Oktober 1941. Von den 389 Männern überlebte kein Einziger.
Liese und Lotte Reinsberg, Hemer Hauptstr. 119
Die Zwillinge Liese und Lotte Reinsberg wurden am 28. Oktober 1913 in Hemer geboren. Nach dem frühen Tod ihrer Eltern kamen sie in die Obhut ihrer Tante Ida. Wie ihr Bruder Erich besuchten sie die Realschule in Hemer, erlernten anschließend jedoch das Schneiderhandwerk – einen Beruf, den sie liebten und auch nach ihrer Flucht 1933 in Amsterdam ausübten. Dort arbeiteten sie im Konfektionsgeschäft „Gezusters Reinsberg“, das sie gemeinsam mit ihrem Bruder führten.Doch der Vernichtungswille der Nationalsozialisten holte sie ein. Nach Erichs Deportation trennten sich ihre Wege für immer. Liese blieb mit Ida in den Niederlanden und heiratete 1941 Carl Justus Neumann aus Düsseldorf. 1942 wurde sie mit ihrem Mann nach Auschwitz deportiert und ermordet. Nur Lotte überlebte. Durch eine Scheinehe gelang ihr die Flucht nach Palästina. Sie gründete dort eine Familie und hatte einen Sohn. Trotz vieler Schicksalsschläge baute sie in Haifa ein florierendes Schneidergeschäft auf und arbeitete als Malerin und Bildhauerin. Lotte wurde fast 99 Jahre alt und starb am 21.02.2012 in Israel.
Isidor Blumenthal
Isidor Blumenthal wurde am 12.11.1887 als Sohn des jüdischen Ehepaares Baruch und Rebekka Blumenthal geboren. Nach der Schule erlernte er das Metzgerhandwerk.
1908 leistete er den Wehrdienst ab und diente auch während des ganzen 1. Weltkriegs in der Armee. 1912 hatte er sich bereits als Pferde- und Viehhändler selbstständig gemacht.
Am 12.6.1931 heiratete er Elfriede Jaeschke aus Hamborn, eine evangelische Christin. Das Paar hatte 2 Kinder, Günther (°31.7.1932) und Hannelore (°21.12.1933), die evangelisch getauft wurden. Ab 1933 wohnte die Familie in der heutigen Hauptstr. 309.
Nach der Machtergreifung führten die gegen Juden gerichteten Boykotte, Berufsverbote und Sonderabgaben ab 1935 zur Verarmung der Familie. In zunehmendem Maß hatte sie auch unter Diskriminierung und Ausgrenzung zu leiden. Den Kindern war ab 1942 der Schulbesuch verboten.
Am 13.11.1938 wurde Isidor Blumenthal für 6 Tage inhaftiert. Ab Januar 1940 musste er in Iserlohn und Dortmund Zwangsarbeit leisten. Er erkrankte schwer an der sog. Nickelkrätze. Im Februar 1944 wurde er im Krankenhaus von Hemer verhaftet und über verschiedene Gefängnisstationen in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert.
Noch im Februar 1945 wurden auch Günther und Hannelore Blumenthal „abgeholt“ und in das Ghetto Theresienstadt deportiert.
Der Vater und die Kinder überlebten, traumatisiert, der Vater mit körperlichen Schäden durch schwere Arbeit und Misshandlungen im KZ (ausgeschlagene Zähne, Verkrüppelung der Hand, medizinische Versuche).
Ein Neustart im Viehhandel gelang nur für kurze Zeit. Restriktive Behördenentscheidungen, Kapitalmangel durch mangelndes Vermögen und schleppend anlaufende Entschädigungsleistungen sowie gesundheitliche Probleme mussten zur Aufgabe führen. Isidor Blumenthal starb am 19.6.1955.









































